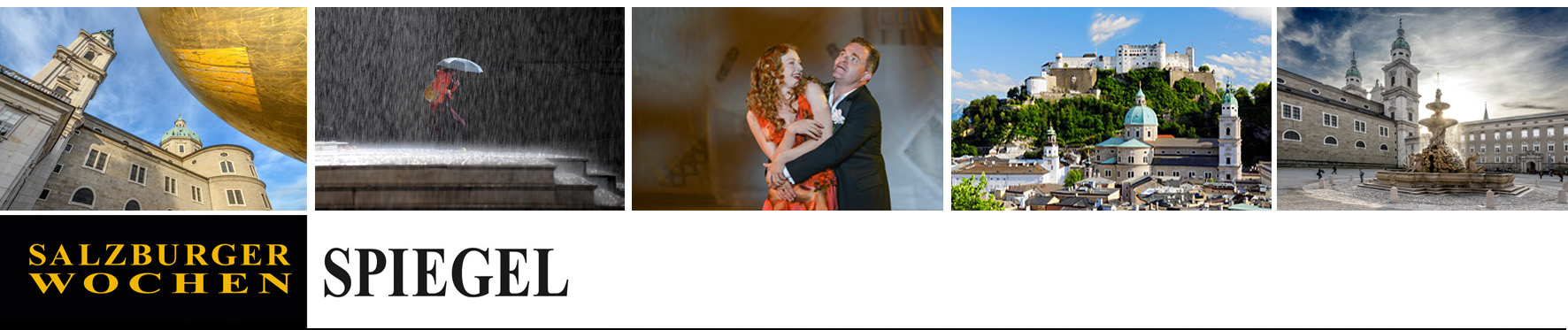„jedermann (stirbt)“ - Schauspielhaus Salzburg
(Rezension)
Des Jedermanns neue Kleider. Am Schauspielhaus Salzburg premierte Rudolf Freys Inszenierung „jedermann (stirbt)“ und sorgt für Begeisterung.
"Das Spiel vom Leben des reichen Mannes" kennt in Salzburg vermutlich jeder. Ach, was heißt hier vermutlich... Seit 99 Jahren wird Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel bereits bei den Salzburger Festspielen aufgeführt. Ein Sommer ohne Jedermann? Für viele undenkbar. Jetzt weht frischer Wind durch Salzburgs Gassen: Der berühmte weiße Geizhals geht in Nonntal um, abseits von Juli oder August. Von wegen Sakrileg, der Festspielheilige durfte sich einer Frischzellenkur unterziehen und kommt in Form von Ferdinand Schmalz' „jedermann (stirbt)“ entsprechend verjüngt auf die Bühne des Schauspielhaus Salzburg, inszeniert von Rudolf Frey (Bühne: Vincent Mesnaritsch, Kostüme: Elke Gattinger, Dramaturgie: Tabea Baumann, Licht: Marcel Busá).
Man hat es wirklich nicht einfach als Gott, schließlich muss man sich mit lästigen Gesellen wie Jedermann herumschlagen. Der Börsianer steht stellvertretend für die neuzeitliche Menschheit und wird von der Tödin zur Rechenschaft gebeten.
Schon in den ersten Minuten von „jedermann (stirbt)“ ist klar: Hier scheint so gar nichts und trotzdem alles wie sonst. Das liegt daran, dass Ferdinand Schmalz' Text im neuen Kleid erscheint. Als Börsianer kapselt sich der Geschäftsmann (Theo Helm ansprechend gierig und dann wieder erstaunlich menschlich verletzbar) vom lästigen Pöbel ab. Der Spielansager gleicht einem griechischen Chor, der abwechselnd und unisono ins Publikum spricht. Die Bühne bringt das mittelalterliche Mysterienspiel ans neuzeitliche Volk, erhebt sich aber auch gleichzeitig zum göttlichen Catwalk.
Darauf treibt es die (teuflisch) gute Gesellschaft bunt (das Ensemble maliziös und lasterhaft). Mal in gebundener Sprache, mal in modernen Dialogen und auch dazwischen wird Kritik in facettenreicher Form geübt. Egal ob Wirtschaft, Kapitalismus, Moral, Flüchlingsthematik oder Grenzzäune – alle zeitgenössischen Brennpunkte werden abgehandelt und vom allegorischen Personal ad absurdum geführt. So viel Jedermann-Treue muss sein. Der Tod tritt als schwarz gekleidete Buhlschaft in Erscheinung. Kristina Kahlert komprimiert äußerst gelungen Femme fatale und Todespersonifikation in einer Figur. Als Dicker und Dünner Vetter setzt Regisseur Rudolf Frey auf Laurel und Hardy Analogien, die Antony Connor und Simon Jaritz wunderbar auf die Bühne bringen. Bei allem Klamauk wohnt dem allegorischen Pärchen aber durchaus ernste Momente inne. Nach Luft schnappend stolpert der Dünne Vetter (Simon Jaritz) über die Bühne, wenn ihm Jedermann symbolhaft die Luft abdrückt und dabei doch meilenweit entfernt ist. Requisiten benötigt Freys Spiel vom Sterben des reichen Mannes nicht und gewinnt dadurch an Symbolhaftigkeit. Schauspiel steht für sich selbst, das Ensemble erledigt den Rest. Jedermanns Frau (Susanne Wende) ist nicht minder lasterhaft unterwegs als ihr Göttergatte, für den sie amoralisch die Buhlschaft auf das Fest bittet. Groß die letzte Szene, als dann doch noch der klagende „Jeeedeeermaaann“-Ruf über die Bühne erklingt – direkt in die letzte Ruhestätte hinein. Dass Gott sauer ist, daraus macht sein Mime Bülent Özdil keinen Hehl. Süffisant steht er über den Dingen und verlangt Rechenschaft. Wenn er seinen Auftritt als Armer Nachbar Gott hat, konvertiert er dessen Attitüde aber ins Gegenteil und bietet devot auch noch die andere Wange zum Schlag an. Jedermanns Mutter (Ute Hamm) indes fürchtet um das Leben ihres Sprosses und würde ihn gerne retten. Sie ist es, die die Tödin beherzt um einen kleinen Aufschub bittet, so ganz unter Frauen. Dafür leiht Ute Hamm der schwarzen Unheilbringerin auch mütterlich ihre Schulter. Und dann sind da noch die Guten Werke und Mammon, beide von Marcus Marotte verkörpert. Da es sich bei „jedermann (stirbt)“ um eine neue Variante handelt, werden die gebrechlichen Gute Werke prompt zur kessen Charity. Eitel trippelt Marcus Marotte dafür in voluminösem Rock über die Bühne und kokettiert mit den eigenen Taten. Als Mammon gibt er sich beherrscht und gülden; er gestattet Jedermann unter seinen Mantel zu kriechen und devot seine Füße zu umklammern. Das Resultat ist ein sehr rührendes und gleichzeitig tief-tragisches Bild voller Ironie und Zeitkritik.
„jedermann (stirbt)“ macht es vor. Hofmannsthal funktioniert auch fernab des Domplatzes, von Juli oder August. Ach was, er profitiert sogar, auch wenn der Anspielungsreichtum unendlich scheint und Gefahr läuft, den einen oder anderen zu überrollen. Aber wer sagt denn, dass Theater immer simple Berieselung sein muss?! (Schauspielhaus)
(Veronika Zangl, 2019)
 |
Fotos:Chris Rogl